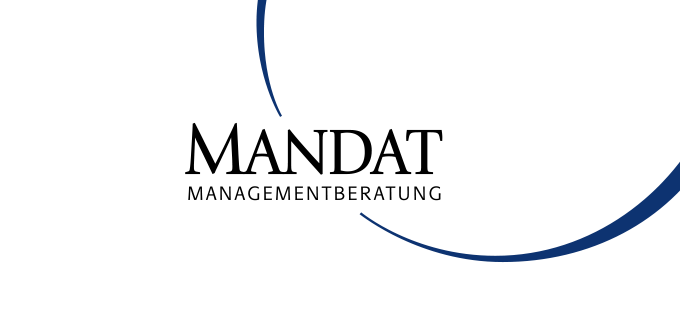Persönliche Größe – eine Wachstumsvoraussetzung
Manche Menschen meinen, sie wären groß, nein riesig. Die wenigsten, die das meinen, sind es wirklich. Persönliche Größe zeichnet sich auch dadurch aus, dass man eben nicht alle Nase lang betonen muss, wie großartig man ist. Persönliche Größe zeigt sich überdies oft auch im vermeintlich Kleinen.
Ein Beispiel für Größe
Ich saß vor einigen Tagen im IC nach Hamburg neben einem mir fremden Fahrgast, was ich normalerweise tunlichst zu vermeiden suche, weil ich es überhaupt nicht schätze, wenn Menschen mir ein Gespräch aufdrängen wollen. Aber die Einzelplätze waren sämtlich belegt. Dem Fahrgast hatte ich ohnehin unrecht getan, ohne dass er es wusste, denn er schwieg. Herrlich: Zeit, um in Ruhe zu arbeiten.
Nach etwa 90 Minuten erhob sich eine Dame zwei Reihen schräg vor uns, ging auf meinen Nachbarn zu und es ergab sich folgender Dialog:
Dame (zu meinem Nachbarn, die Hand ausstreckend): „Ich möchte mich gerne bei Ihnen entschuldigen. Ich war tierisch genervt und Sie haben es abbekommen.“
Mein Nachbar: „Ach, war doch nicht der Rede wert.“
Dame: „Doch, doch, es ist mir ein Anliegen, mich zu entschuldigen.“
Mein Nachbar akzeptierte die Entschuldigung (richtigerweise!), die beiden gaben sich die Hand und ich dachte: ‚Das hat wahrlich Größe.‘ Offensichtlich hatte die Dame lange mit sich gerungen – der vorangegangene Streit musste fast zwei Stunden her gewesen sein, denn ich hatte ihn nicht mitbekommen –, um dann für sich zu befinden, dass sie die Situation klären wollte, bevor sich die Wege der beiden trennen würden.
Was können wir lernen?
Die Dame hat Größe gezeigt. Und persönliche Größe führt zu weiterem persönlichen Wachstum. Wachstum beginnt immer bei uns selbst. Es hat etwas zu tun mit dem Überspringen des eigenen Schattens, dem gelegentlichen Verlassen der Komfortzone (unter der Bedingung, dass man ein Rückfahrtticket in die Komfortzone hat), mit der Ausführung von etwas Ungewohntem. Schlussendlich hat persönliches Wachstum auch etwas mit Vergeben zu tun.
Vergeben zu können, wiederum, ist echte Größe.
Ihr Guido Quelle
(c) 2011, Prof. Dr. Guido Quelle, Mandat Managementberatung GmbH