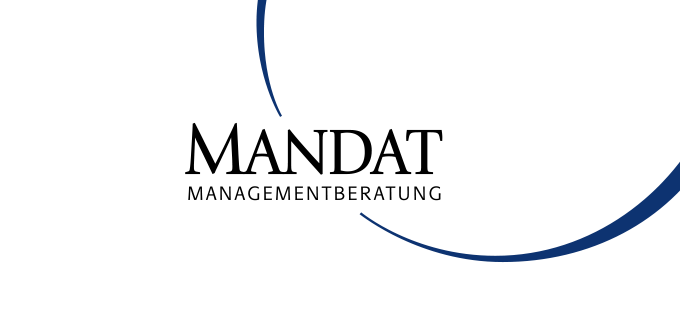Die persönliche Sicht: Selbstbedienung der öffentlichen Hand.
Weniger Staat? Längst ein Witz. Ein schlechter, zudem. Klar, es stand in der Presse und wir hätten es wissen müssen: Viele klamme Kommunen würden Steuern erhöhen, um die knappen Kassen aufzubessern, aber dennoch reiben sich manche Bürger und Unternehmensvertreter – längst nicht mehr verwundert, sondern inzwischen massiv verärgert – die Augen, wenn sie ständig neue Steuerbescheide erhalten. Beispiel Dortmund: Hundesteuer für zwei Hunde? Im Handstreich um sechs Prozent erhöht (der zweite Hund kostet im Übrigen ohnehin etwa 50 Prozent mehr als der Erste, Hundesteuer ist eben eine Luxussteuer). Grundsteuer? Satte 13 Prozent Plus. Das nenne ich eine saftige Preiserhöhung – ohne jegliche Gegenleistung. Respekt, nicht schlecht!
Liebe Kommunalpolitiker, man mag sich im Stadtrat noch so einig sein, aber das Maß ist voll. Genauer genommen ist es übervoll. Das Argument, dass der Bürger ja immer mehr Leistung erhielte und alles teurer würde, zieht nicht, weil der Bürger nicht gefragt wurde, ob er die vermeintlichen Zusatzleistungen möchte und weil fraglich ist, ob es überhaupt Zusatzleistungen gibt, die erforderlich sind.
Dortmund ist kein Einzelfall. Bedarf es weiterer Beweise dafür, dass die Kommunalpolitk hilflos, überfordert, mit ihrem Latein am Ende ist? Die Kommunen leben über hre Verhältnisse, der öffentliche Dienst ist ein überbordendes Element geworden. Im Gegensatz zu Unternehmen, bei denen Sparen nicht das oberste Gebot ist, sondern das Erzielen von Umsatz im Vordergrund stehen muss, ist es im öffentlichen Dienst genau umgekehrt: Die Wachstumsintelligenz muss aus dem Sparen und aus der Effizienz kommen und nicht aus dem Schröpfen der Bürger und der Unternehmen. Ich erwarte, dass gleiche Leistungen jedes Jahr günstiger werden, weil Routinen gelernt und Automatisierungspotenziale besser genutzt werden, weil weniger Menschen pro Leistungseinheit erforderlich sind und weil ein systemimmanentes Bestreben nach weniger Staat besteht. Ich erwarte nicht, dass gleiche Leistungen teurer werden. Warum auch? Wenn Unternehmen so arbeiten würden, gingen sie unter.
Im öffentlichen Dienst geschieht aber genau das: Die öffentliche Hand greift nach allem, dessen sie habhaft werden kann. Statt Optimierung findet Selbstbedienung statt, es ist ja schließlich noch etwas zu holen und der Steuerpflichtige kann sich nicht wehren. Der Nebeneffekt: Frust und Ärger statt Respekt und Akzeptanz, statt vielleicht sogar Unterstützung. Aber wenn man sich erst einmal von denjenigen abgekoppelt hat, die unseren Staat und damit auch die Kommunen finanzieren, wenn man erst einmal völlig losgelöst von den Realitäten agiert, dann lebt es sich zunehmend einfach. Wie war das noch? Wenn sie kein Brot haben, sollen sie eben Kuchen essen.
Ich bin von diesem Vorgehen enttäuscht. Und ich weiß: Ich bin nicht alleine. Wachstumsintelligenz und Zukunftsfähigkeit gehen jedenfalls anders.
©2015 Prof. Dr. Guido Quelle