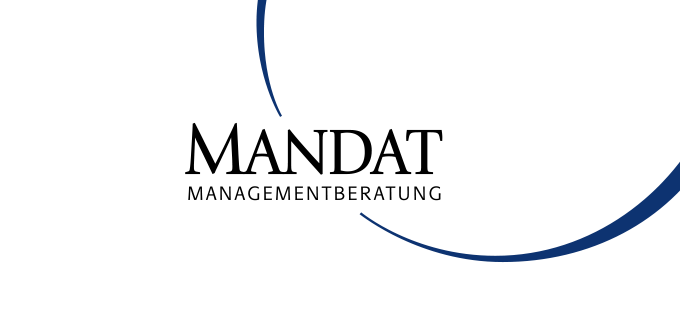Mandat Wachstums Wochenstart Nr. 675: Die Tage werden langsamer länger
Haben Sie es gemerkt? Nein, sie haben es nicht gemerkt: Die Tage werden langsamer länger. Vielleicht haben sie es mit Blick auf den Kalender im Sinn, vielleicht haben sie es durch das mehr oder weniger regelmäßige Betrachten der Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten im Blick, aber gemerkt werden sie es nicht haben. Der kalendarische Frühlingsanfang ist der Tag, nach dem sich der Zuwachs an Tageshelligkeit reduziert. Die Tage werden weiterhin länger, aber langsamer als zuvor.
Mathematisch gesehen handelt es sich um den Wendepunkt auf der Parabel. Der Wendepunkt kennzeichnet den Punkt der höchsten Steigung. Danach flacht die Steigung ab. Es findet also weiterhin Wachstum statt, aber das Wachstum erfolgt langsamer als zuvor.
Damit sind wir auch bereits mitten im Thema „Wachstum“: Typische Wachstumskurven verlaufen so wie die Kurven der Tageslängen. Sie verlaufen parabelförmig und wir sind gehalten, das zu tun, was in der Natur mit der Tageslänge nicht möglich ist, nämlich die Kurve zu beeinflussen. Dazu müssen wir wissen, wo wir stehen, welchen Punkt wir auf der Kurve gerade einnehmen und vor allem müssen wir eine Sensibilität dafür entwickeln, dass wir eine Veränderung nicht unbedingt sofort bemerken. Ähnlich wie bei der geringer werdenden Zunahme der Tageslänge stellen wir nicht unmittelbar fest, wann sich ein geringeres Wachstum einstellt. Ja, wir können mit Kennzahlensystemen arbeiten, aber wir wissen ja nicht, ob diese Momentaufnahme, die das Kennzahlensystem uns eröffnet, ein Trend ist oder ob es sich eben um eine Momentaufnahme handelt.
Abgesehen davon, dass systemisches Denken und exponentielles Denken in der Schule nicht und an der Hochschule wenig gelehrt wird, wir also wenig Verständnis für dieses System- und exponentielle Denken haben – man erinnere sich an die Pandemie –, brauchen wir auch ein Gefühl dafür, eine sensibilisierte Wahrnehmung dafür, wann das Wachstum geringer wird, um einwirken zu können und die Kurve positiv zu verändern.
Überdies ist der Wendepunkt, also der Punkt der höchsten Steigung, der ideale Zeitpunkt, über Innovationen nachzudenken und diese zu starten, auch wenn zu diesem Zeitpunkt bereits sehr hohe Auslastung herrscht und der Betrieb hinreichend beschäftigt ist. Schließlich müssen wir uns vor Augen führen, dass eine Innovation nicht im Nu entwickelt und schon gar nicht am Markt erfolgreich platziert ist.
Wie ist es bei Ihnen? Wie ist es um das Systemverständnis bestellt? Wie ist es um das Bewusstsein bestellt, an welchem Punkt der Wachstumskurven sie sich befinden? Wie ist es darum bestellt, dass wahrgenommen wird, wie sich das Wachstum entwickelt? Zahlreiche unserer Beratungsmandate drehen sich aktuell um diesen Punkt.
Und jetzt: genießen Sie die immer noch länger werdenden Tage.
Auf eine gute Woche
Ihr und Euer
Guido Quelle