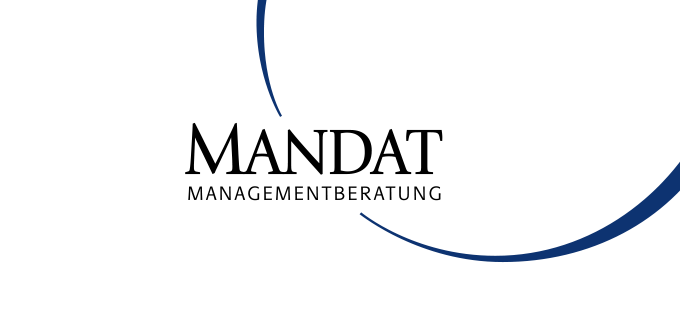Gestern fand sie statt: die zweite Telekonferenz der Wachstumswerkstatt 2012, persönlich gehalten von Prof. Dr. Guido Quelle. Wesentliche Erkenntnis: Die Marketing-Abteilung ist eben doch nicht mehr die „Insel der Glückseligkeit“, sondern muss sich harten Herausforderungen stellen. Wenn sie das tut, kann sie zu einer Triebfeder des Wachstums werden. Wie sie das tun kann, steht unter anderem …
… in dieser Presseinformation:
Wie das Marketing zur Triebfeder des Unternehmenswachstums wird – Guido Quelle in der Wachstumswerkstatt
Dortmund, 20. März 2012
„Wenn das Marketing behauptet, es sei nicht messbar, wird es dringend Zeit, diesen verborgenen Wachstumshebel zum Vorschein zu bringen.“ So startete Prof. Dr. Guido Quelle am Montag in die zweite Mandat-Telekonferenz des Jahres. Vor mehr als 200 akkreditierten Teilnehmern zeigte der Mandat-Geschäftsführer auf, dass das Potenzial des Marketing als Triebfeder für das Unternehmenswachstum nur selten ausgeschöpft sei. Viel zu oft definierten sich Marketingleute nur über ihre Aufgaben im Tagesgeschäft, ließen Schnittstellen links liegen – und versäumten häufig, Verantwortung für Resultate zu übernehmen und sich an ihnen messen zu lassen.
„Kein Wunder, schließlich werden im Marketing – insbesondere im Mittelstand – noch viel zu selten Verantwortungen mit echten Resultaten verknüpft und mit Messgrößen unterlegt“, so der Wachstumsexperte. Einen möglichen Einwand bezüglich der Eignung von Kennzahlen nahm Quelle gleich vorweg: „Sicher sind Messgrößen auch im Marketing selten überschneidungsfrei. Jedoch fördert bereits der Prozess, geeignete Messgrößen zu definieren und zu verfolgen, zu einer Offenlegung der wahren Ergebnisverantwortlichkeiten – und häufig zu einer erstmaligen Festlegung fassbarer Marketing-Ziele. Zudem fördern Messgrößen das Standing des Marketing im Unternehmen mit soliden Fakten und korrigieren das in vielen Köpfen vorhandene bunte Kreativbild viel- und zugleich nichtssagender Marketing-Konzepte. Außerdem stößt bereits der Findungsprozess solcher Messgrößen häufig eine Optimierung der Marketing-Abläufe an.“
Vom Abwickler zum Kundenbinder
Quelle berichtete auch aus seiner Beratungserfahrung: „Wenn ein Großhändler sein Marketing nicht mehr nur für die Veranstaltung von Kundenseminaren und das Eintreiben von Werbekostenzuschüssen einsetzt, sondern ihm die strategische Aufgabe zuweist, die Kundenbindung zu steigern und die Wahrnehmung durch den Kunden zu fokussieren: Dann ist die Wahl der geeigneten strategischen, taktischen und operativen Messgrößen eine wesentliche Hilfestellung für die Definition von Verantwortungen und liefert zugleich ein Bild der erwarteten Leistung.“ So konnte das Marketing über eingedämmte Kundenabwanderungen und über einen gleich mehrfach erhaltenen, unabhängigen Preis für präferierte Kundenpartner den Erfolg seiner Arbeit eindeutig belegen.
Mit und trotz Kreativität ans Ziel
Dass Kreativität wichtig ist fürs Marketing, sei keine Frage für Guido Quelle. Jedoch bringe erst die Kombination aus Kreativität und Umsetzungskompetenz den Erfolg:
• Klare Aufgaben fürs Marketing, die die erwarteten Ergebnisse mit definieren,
• Resultate, die durch den jeweiligen Stelleninhaber verantwortet werden sollen,
• ein funktionierendes Team als kleine Gruppe, die sich gegenseitig gemeinsamen Zielen verpflichtet,
• idealerweise verbunden mit Mitarbeitern, die Erfahrung und Know-how aus vor- oder nachgelagerten Wertschöpfungsstufen mitbringen
Tagesgeschäft ohne Alltagsroutine
Quelle warnte davor, den Beitrag des Marketing zum wachstumsorientierten Unternehmen zu unterschätzen und im Tagesgeschäft versanden zu lassen: „Wenn Sie Ihr Marketing in das ‚Wie‘ einbeziehen und über die Auswirkungen seiner Arbeit nachdenken lassen, wenn Sie Ihr Marketing in bereichsübergreifende Projektarbeit verantwortlich einbeziehen, um Durchsetzungswillen und Durchsetzungsvermögen zu fördern, wenn Sie Ihr Marketing in entscheidend Neues einbinden, wie das Entwickeln der neuen Unternehmensstrategie oder in die Produktinnovation – und jeweils entsprechende, konkrete Messgrößen gemeinsam entwickeln: Dann durchbrechen Sie die klassische Unlust des Marketing an der Tagesroutine und schöpfen dessen Potenzial optimal aus.“
Die Wachstumswerkstatt
Die nächste Mandat-Telekonferenz der Wachstumswerkstatt 2012 findet statt am 23. April 2012 zum Thema „Vertrieb: Wie Sie Silos aufbrechen und Wachstum vorantreiben“. Die Impulsvorträge am Telefon zu den wichtigsten Bereichen, in denen Wachstumsbremsen zu lösen sind, richten sich an Unternehmer, Vorstände, Geschäftsführer und seniorige Führungskräfte. Mehr Informationen unter /menu/produkte/telekonferenzen/telekonferenzen-2012/