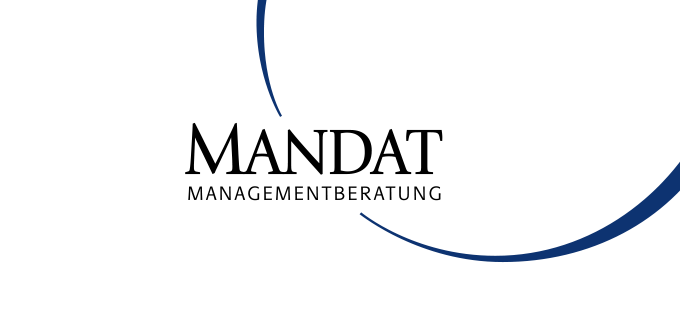Mandat Wachstums Wochenstart Nr. 692: Champagner
Diesen Wochenstart verfasse ich zwei Stunden nach einem Beratungsgespräch mit einem Unternehmer, der gerade frisch erholt aus der Champagne wieder zurück in Deutschland ist, mit dem ich mich eingangs unseres Gesprächs über die Champagne und Champagner unterhalten habe und der sich sicherlich hier wiederfinden wird. Danke für das Thema!
Kennen Sie ein Schaumwein-Getränk, das so mit Festlichkeit konnotiert wird, wie Champagner? Etwa Cava? Winzersekt? Crémant? Spumante? Vermutlich ist das nicht der Fall. Die genannten gehören jedenfalls nicht dazu.
Champagner ist seit dem 29. Juni 1936 in Frankreich als „Appellation d’Origine Contrôlée“ geschützt. Dies muss nicht einmal auf der Flasche vermerkt werden. Kein Schaumwein, der nicht den Champagner-Kriterien entspricht, darf sich „Champagner“ nennen, auch Teile des Wortes, die eine Verbindung nahelegen, darf ein Produkt, das nicht den Kriterien entspricht, nicht verwenden. So zum Beispiel ist „nach Champagnermethode hergestellt“ verboten. Der BGH hat 2002 sogar entschieden, dass „Champagner bekommen, Sekt bezahlen“ nicht durch einen Elektronik-Großmarkt verwendet werden darf.
Nun ist „Champagner“ ja nur eine Produktgattung. Aber es ist gelungen, dass diese Gattung zum vermutlich festlichsten Getränk aufgestiegen ist. Warum ist das keinem deutschen Winzersekt in der Form weltweit gelungen? Warum nicht dem Cava? Warum nicht dem Crémant? Die Produktqualität ist mitunter durchaus vergleichbar, daran kann es nicht liegen.
Es liegt, natürlich, an der Marke. Eine lange, lange Strecke ist erforderlich, um so einen Vorsprung zu bilden und ihn zu halten und dabei spreche ich noch nicht von den über 900 Jahren, die seit der Gründung des Weinbaugebietes „Champagne“ im Jahr 1114 vergangen sind, wenngleich diese lange Historie sicherlich auch einen Beitrag leistet. Aber zu Schaumwein wurde Champagner „erst“ im 17. Jahrhundert. Das älteste Champagnerhaus, das heute noch existiert, ist Ruinart, gegründet 1729, also im 18. Jahrhundert und erst im 19. Jahrhundert wurde der Champagner zu dem, was er heute ist: Ein Luxusgetränk, das auf „echten Festen“ nicht fehlen darf.
Jetzt kommt das Besondere: Alle Anbieter von Champagner profitieren von dieser Markenstärke der Produktgattung. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass unter der Gattung „Champagner“ zahlreiche Wettbewerber um Wettbewerbsvorteile ringen. Dom Perignon, Moët & Chandon, Heidsieck, Pommery, Roederer oder eben Ruinart, die Liste der Anbieter umfasst einige Dutzend Unternehmen und Produktmarken.
Jede dieser Produktmarken hat wieder die Aufgabe, ihr eigenes Profil zu schärfen. Das Zurückziehen auf „Champagner“ genügt bei weitem nicht. Warum diesen Champagner und nicht den anderen? Diese Antwort muss sitzen und jede Marke ist gut beraten, den Konsumenten und Profi-Kunden gute – oft emotionale – Argumente an die Hand zu geben, damit diese die „richtige“ Kaufentscheidung treffen. Wenn es darauf ankommt, muss es mehr sein als nur die sachliche Produktqualität. Da reicht auch nicht „Der Aldi-Champagner schmeckt super, top Qualität, super Preis“.
In unserer Beratungspraxis erleben wir ähnliches oft bei Unternehmen, die einer Unternehmensfamilie angehören. Das können Verbundgruppen sein, es können Konzerne mit Submarken sein, es können aber auch Familienunternehmen sein, die ihren Tochtergesellschaften ein Stück vom Glanz abgeben.
Dann kommt aber der entscheidende Punkt: Die einzelnen Gesellschaften müssen diese „Dachmarke“ für sich nutzen UND selber ein Profil entwickeln. Manche empfinden das als schwierig.
Wir denken sofort, immer: Welch eine Riesenchance!
Auf eine gute Woche
Ihr und Euer
Guido Quelle