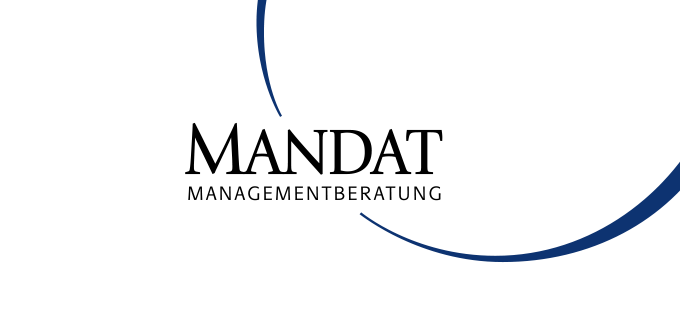Mandat Wachstums-Wochenstart Nr. 720: Es geht nicht immer um Funktion
Unser Mandat-Jahres-Kick-Off liegt nun schon drei Wochen zurück. Es war super erfolgreich, wir haben zahlreiche Aktivitäten und Maßnahmen daraus abgeleitet, unser Jahr steht unter dem Leitthema „JUMP 2026!“ und wir sind sehr guter Dinge wieder nach Hause gefahren.
Wie immer haben wir viel Zeit miteinander verbracht und da wir beruflich viel in Hotels sind, kennen wir unterschiedliche Levels. Der Schnitterhof, in dem wir tagten, gefällt uns sehr gut, das gesamte Paket stimmt. Beginnend bei willkommenen Hunden, mit Zahnsticks auf dem Zimmer sowie einem Türschild „Hund auf dem Zimmer“ und Anleitungen für den richtigen Umgang mit Hunden in diesem Hotel – nebst der Adresse des nächsten Tierarztes (für Hundehalter immer wichtig), sind die Mitarbeiter willens und fähig. Das Essen ist gut, alle sind freundlich und wir haben wieder einen prima Tagungsraum erhalten, diesmal einen ganz neuen.
Wir kommen wieder.
Das ist aber nicht mein Punkt heute. Mein Punkt ist der folgende: Wenn man von den Tagungsräumen zu den Waschräumen, den WCs, möchte, geht man eineinhalb Treppen herab. Vor den WC-Türen? Ein Sofa, einige Hocker, an der Wand ein Regal mit Büchern, Spiegelattrappen.
Mir ist dies aufgefallen, als ich genau hinschaute. Haben die Objekte eine Funktion? Würde sich irgendwer dort unten, im Untergeschoss, auf die Couch setzen? Auf die Hocker? Würde sich irgendwer dort ein Buch aus den Regalen nehmen?
Nein.
Die Objekte haben keine Funktion in ihrem objektbestimmten Sinn. Sie sind einfach da, um die Umgebung schöner zu machen.
Manchmal geht es nicht um rationale Funktion. Manchmal geht es einfach darum, Dinge, Umgebungen, Situationen, Bereiche schöner zu machen. Dafür bedarf es der Investition. Controller rechnen so etwas sofort als entbehrlich heraus. Unternehmer aber wissen, dass es nicht nur um Ratio, sondern auch um Emotio, nicht nur um Funktion, sondern auch um Wohlfühlen geht.
Ich weiß, dass die Wenigsten von Ihnen ein Hotel betreiben, aber wir alle haben Felder, in denen wir es für unsere Kunden, Mitarbeiter, für uns selbst, schöner machen können.
Wo sind diese Bereiche bei Ihnen?
Was tun Sie dafür?
Auf eine gute Woche!
Ihr und Euer
Guido Quelle