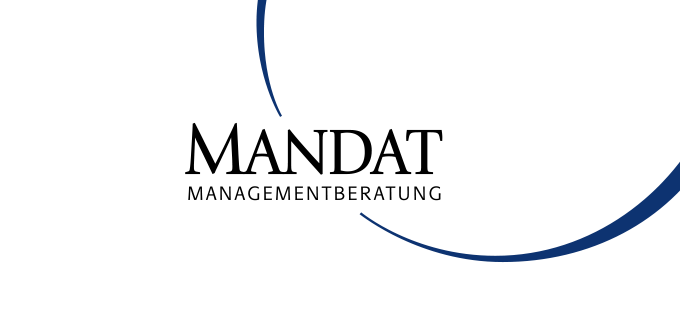Was zwischen Private Equity-Gesellschaften und ihren Unternehmen steht, Teil 5: PI („Project Inflation“)
Dies ist der fünfte und letzte Teil unserer kurzen Serie über das Heben von Potenzialen im Verhältnis zwischen Private Equity-Gesellschaften und ihren Portfolio-Unternehmen. Die anderen Beiträge sind mit Klick auf die Kategorie „Private Equity“ hier abrufbar. Heute geht es um eines meiner Dauer-Lieblingsthemen: Um das Weglassen.
Wie viele „Masterpläne“ wurden schon erstellt? Manchmal heißen sie auch anders, wie zum Beispiel „Growth Agenda“, „Future Map“ oder „Roadmap 20xx“ oder … denken Sie sich etwas aus. Wie viele Managements haben sich schon durch diese Übung gequält? Wie viele Projekte wurden schon aus diesen „Masterplänen“ entwickelt? Unzählbar viele.
Wie viele Projekte wurden tatsächlich realisiert? Und wie viele waren letztendlich erfolgreich? Bedeutend weniger. Das hindert aber nahezu niemanden daran, das Heil eines Unternehmen in der Anzahl der Wachstumsprojekte zu suchen. Der Frust, der sich auftut, wenn sich angesichts einer unübersehbaren und unübersichltichen Projekte-Landschaft die Prioritäten laufend verschieben, beziehungsweise, wenn eigentlich niemand mehr weiß, welches Thema aktuell welche Priorität genießt – was den Vorteil hat, dass man irgendwie schon immer mal an etwas Richtigem arbeitet –, dieser Frust ist, indes, enorm.
Ich habe diesen Zustand, auch in meinen Vorträgen mit „PI“ abgekürzt: Project Inflation, Projektinflation. Unserer Beobachtung zufolge gibt es in den Unternehmen nicht zu wenige Projekte. Es gibt zu viele. Nicht jeder, der MS Project auf dem Rechner hat, ist ein Projektleiter. Nicht alles, was Projekt heißt, ist ein Projekt. Das Arbeitsplatzberechtigungsprinzip „Ich habe ein Projekt, also bin ich“ ist wachstumsfeindlich. Wenn im Verhältnis zwischen Private Equity Gesellschaft und einem Portfolio-Unternehmen plötzlich PI entsteht, hat dies den zusätzlichen Nachteil, dass die ambitionierten und meist festgeschriebenen Ziele der Investoren in weite Ferne geraten. Dann aber wird das quartalsmäßige Board Meeting zur Qual.
Streichen Sie 50 Prozent Ihrer internen Projekte. Addieren Sie dann 10 Prozent marktgerichtete Projekte. Damit sind Sie auf einem wesentlich besseren Pfad als heute. Wir haben eine Methodik entwickelt, die genau dies ermöglicht, unter klarer Wertbetrachtung der einzelnen Projekte. Die Wirkung ist frappierend.
© 2014, Prof. Dr. Guido Quelle, Mandat Managementberatung GmbH, Dortmund, London, New York.